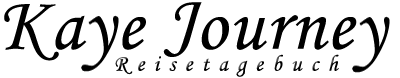9.11. bis 10.11.14 – Von Mumbai nach Udaipur
Bevor wir am Nachmittag unsere erste große Zugreise antreten, schlendern wir noch einmal durch das Bazaarviertel nördlich des CST Bahnhofs. Es ist Sonntag, fast alle Geschäfte sind geschlossen, nur die Obst- und Gemüseverkäuferinnen schwitzen am Straßenrand; ein paar Typen wollen uns unbedingt originale Sonnenbrillen verkaufen und verfolgen uns über mehrere Straßenblöcke. Wir suchen den Mumba Devi Tempel und finden stattdessen eine wunderschöne Moschee, an deren Eingang, wie so oft, der verwaiste Metalldetektor wie ein Fremdkörper das einladende Ensemble aus geschwungenen Bögen, sanften Farben, gemusterten Türmchen und hineinströmenden Betenden durchbricht.
Eingedeckt mit Bananen und Getränken machen wir uns auf den Weg zum Bahnhof. Trotzdem wir 1,5h für den Weg zum Zug einplanen, verpassen wir fast die Abfahrt. Wir fahren mit der Rikscha zur Churchgate Station und nehmen den Local Train nach Norden. In Dadar, einer Station vor Bandra, steigen Menschenmassen in unser Abteil ein. Wir sitzen eingequetscht in der hintersten Ecke und erklären einem Mitfahrer, dass wir an der nächsten Station raus müssen. Er wird sofort hektisch, zieht meinen Rucksack von der Gepäckablage und beginnt sich den Weg zur Tür zu bahnen, schubst, drängelt, immer höflich, doch mit Kraft und Nachdruck. Wie in einem Tetris-Spiel wird der Rucksack mit einem Menschenplatz getauscht, ich werde nachgeschoben, Karimes Gepäck über die Köpfe gereicht; zuletzt quetscht auch er sich durch die Menschenmenge. Alle machen mit, bleiben ruhig, während wir Körper an Körper, Rucksäcke an Rücken, Bäuchen und Köpfen vorbeischieben; alle helfen, als könne man nur gemeinsam diese Enge überstehen, zu Hunderten in einem Abteil – doch irgendwie geht es. Man arrangiert sich mit Höflichkeit. Alle drängeln, doch niemand beschwert sich. Keiner verliert die Geduld, keiner meckert. Irgendwie schaffen wir es an der Bandra Station aus dem Zug. Unsere Mitfahrer sind ebenso froh wie wir und winken uns zufrieden nach, während wir im Strom der Menschen auf der Plattform des Bahnhofs verschwinden.
Nur leider fährt unser Nachtzug hier gar nicht ab. Es gibt noch einen anderen Bandra Bahnhof, etwa 10 Minuten entfernt. Abfahrt ist in einer Viertelstunde. Wir laufen zum Rikschastand. Zu siebt, samt Gepäck, geht es hupend und ruckelig durch Bandras enge, staubige Gassen. Karime hängt mit halber Arschbacke links auf dem Fahrersitz. Auf der rechten Seite hängt ein weiterer Fahrgast. Am Gleis springen die Fahrgäste der reservierungsfreien „Sleeper Class“ bereits in den einrollenden Zug. Männer quetschen sich durch Fensteröffnungen, Gepäck wird über 10 andere Passagierköpfe hinweg in den Zug geworfen. Alle versuchen einen Fensterplatz zu ergattern. Zu zehnt sitzen sie auf den Zugbänken und schauen der 17-stündigen Bahnfahrt entgegen. Wir haben uns zwei Betten in einem 4-Personen-Abteil gebucht und stehen am falschen Ende des Zuges, welcher gefühlte fünf Kilometer lang ist. Nach endlosen Minuten erreichen wir verschwitzt unsere Betten. Leider verliere ich auf dem Weg die Hälfte meiner Wasserflaschen. Nun müssen wir 17 Stunden Fahrt mit zwei Litern Wasser, einer Flasche Mangosaft, zwei Samosas, zwei Blätterteigtaschen, einer Packung Kekse, je 100g Cashewnüssen und Pistazien und vier Bananen überstehen.
Unsere Mitfahrer, ein indisches Ehepaar aus Udaipur, bieten uns kurzerhand Chai Tee, Chapati Brot, Pudding, eine selbstgemachte, scharfe Chilipaste und ein gelbes, säuerliches Gebäck, welches wie fermentierter Reiskuchen schmeckt, an. Wir schenken Ihnen unsere Nüsse und Kekse. Da unsere Hindikenntnisse noch zu wünschen übrig lassen, sind wir dankbar über jedes englische Wort. Mit Händen und Füßen werden Herkunftsorte, Reiserouten und Dankbarkeitsbekundungen ausgetauscht. Gegen 22:00 legen wir uns zur Nachtruhe.
Die Betten sind überraschend gemütlich. Wir dösen schnell weg und werden mitten in der Nacht unsanft von einer lauten Stimme geweckt, die zu einem korpulenten, hektischen Mann gehört, der plötzlich vor meinem Bett steht und „9 Number“ schreit. Er hat das Bett des Ehemannes gebucht, dessen Platz wohl eigentlich auf der anderen Seite des Flures ist und scheint zu einem Tausch wenig bereit. Traurig schauen wir unserem ehemaligen Abteilfreund hinterher, der unfreiwillig seine Decke zusammenrollt und im dunklen Flur verschwindet. Nun blicke ich in die starrenden Augen meines neuen Bettnachbarn, der mich skeptisch von oben bis unten mustert. Wo ich herkomme, wo ich hin will, was mein Beruf sei. Ich reibe meine müden Augen und gebe brav Antworten, während ich erfolglos versuche eine Kakerlake, die gerade über meinen Tisch huscht, einzufangen. Kommentarlos stellt der neugierige Mann seine Wasserflasche auf die fliehende Schabe und fragt erneut nach meinem Beruf. Tour Guide und Musiker, sage ich. Er rümpft seine Nase, gerade so als hätte ich „bettelnder Wanderzirkusclown“ gesagt, dreht sich um und knipst das Licht aus. Mein Beruf war wohl nicht ansprechend genug. Ich frage mich später, was wohl geschehen wäre, hätte ich Diplompsychologin gesagt und wünsche mir heimlich meinen alten Nachbarn zurück, während mein klassenbewusster Neumitfahrer im Schlaf einen Wald absägt.
Am Bahnhof in Udaipur kaufen wir uns sogleich ein Ticket nach Ajmer für den nächsten Tag und buchen uns am See ein Zimmer für die Nacht. Wir wollen in anderthalb Tagen die Stadt erobern, doch unsere Köpfe dröhnen noch von der Zugfahrt und wir verschlafen die ersten Udaipurstunden in unserem neuen Bett. Am frühen Nachmittag treibt uns der Hunger hinaus auf die Straßen. Vor unserem Hotel hupen die Motorräder und Rikschas um die Wette. Meine Augen schmerzen bei jeder Bewegung. Wir überqueren den See auf der Daiji Brücke und gelangen zum viel ruhigeren Hanuman Ghat. Am Fuße der kleinen Halbinsel baden Jungen im Fluss. Drei Kinder mit abgerissener Kleidung strecken uns die offenen Hände entgegen; ein kleines Mädchen freut sich über meine Wasserflasche, welche sie so vehement vor den anderen Kindern verteidigt, dass sie innerhalb weniger Minuten den Deckel und den halben Inhalt verliert, bevor sie überhaupt einen Schluck trinken kann. Wir suchen uns ein Restaurant mit Dachterrasse, bestellen Currygerichte, Reis und Naanbrot und treffen Gafur Khan, den Kellner, Restaurantmanager, Mann für alles. Er hat augenblicklich keine Lust mehr auf die anderen Gäste und setzt sich zu uns. Gafur ist ein stolzer Rajasthani. Er zückt das Handy und zeigt uns Bilder seiner Heimat, Jaisalmer, des schönen Forts in der Wüstensteppe Rajasthans, welches leider nicht auf unserem Reiseplan ist. Er zeigt uns Bilder seiner Geschwister, seiner Neffen, seines Hauses, seiner drei Kamele. Bilder der Wüste. Wunderschöne Landschaften, in welche man zu Recht verliebt sein kann. Seine Geschwister sind verheiratet, die Eltern zufrieden und so lassen sie ihn in Ruhe, den jüngsten Sohn, der viel lieber aus Liebe heiraten will. In Udaipur verdient er sein Saisongeld und schaut nach der Zukünftigen. Hier, und auf Facebook, wo er ein wunderbar extrovertiertes Profil pflegt: Gafur mit dicker Sonnenbrille, großen Autos, prächtigem Schnurbart. Wir schießen gemeinsam Fotos und werden zum Abschied lange gedrückt. Später am Abend als meine Kopfschmerzen mir halb den Verstand rauben, gibt Gafur mir noch eine beherzte Kopfmassage, quetscht mir mit den Handflächen in die Augen, reibt meine Kopfhaut so lange, dass ich fürchte mit einer großen Dreadlock weiterreisen zu müssen, reist meinen Kopf herum und lässt mein Genick dreimal rechts und dreimal links knacken. Ich lasse alles tapfer über mich ergehen, doch die Kopfschmerzen sind leider nur die Vorhut der kommenden Tage, an welchen mir keine Massage der Welt mehr helfen kann. Gafur sagt, ich solle mehr Kamelmilch trinken, ich hätte ja kaum Muskeln, und zeigt mir ein paar Gymnastikübungen für den Morgen. Hätte ich doch auf ihn gehört.
11.11.11 Udaipur-Pushkar
Am nächsten Morgen stehen wir früh auf und filmen den Sonnenaufgang am Dhobi Ghat, der Waschterrasse des Sees. Während Karime die Sonnenstrahlen einfängt, schrubben sich die Männer des Ortes die Nacht aus den Gliedern. Ich sehe sie Gebete murmeln, bevor sie sich in’s Wasser ducken. Gewissenhaft werden Haut und Haare sowie alle Kleider eingeseift und im nachtkalten Wasser des Sees reingespühlt. Wieder habe ich unfreiwillig einen neuen Kompagnon. Ein Mann folgt mir auf Schritt und Tritt und erzählt seine Geschichten, die meist ein Ziel verfolgen: dass meine Rupees zu seinen Rupees werden. In seiner ersten Geschichte ist er der beauftragte Reinigungsmensch, der die Terrassen sauber hält, wofür er natürlich kein Geld bekommt, was jedoch ganz schön teuer sei. Das mag stimmen, doch als ich nicht gleich die Geldbündel zücke, ist er plötzlich ein Lehrer, der in einer Schule ganz kostenlos Kindern das Malen beibringt. Udaipur ist berühmt für Seidenmalerei. Zu guter Letzt ist er natürlich auch noch Künstler, seine Werkstatt nur ein paar Meter entfernt und die Kunstwerke unvergleichlich preiswert. Ob wir gleich mitkommen würden. Wir wollen nicht. Fast eine Stunde lang versucht er uns das Versprechen in seiner Werkstatt vorbeizuschauen abzuringen. Doch wir wollen nicht. Als wir später zur Stadt zurückkehren, taucht er erneut auf. Er hat an der nächsten Ecke auf uns gewartet, eine weitere Stunde. Es nervt und ist doch irgendwie bezeichnend, wie sehr er uns als Kunden gewinnen will. Dennoch bin ich naiverweise enttäuscht und sage ihm, dass es mich traurig macht, dass man mir doch fast immer, sobald ich mit jemandem in’s Gespräch komme, etwas verkaufen will. So habe ich kaum noch Lust mich auf Gespräche einzulassen. Daraufhin sagt er nur: Only look, don’t buy. Ach mann.
Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Zum Frühstück esse ich Aloo Puri, würzige Kartoffeln mit Champignon-Omelette und Masala Soße. Trinke Ingwer-Zitronen-Tee. Esse noch zwei Toast mit Honig. Kaum zu glauben, dass ich in den nächsten Tagen kaum noch etwas essen kann.
Am Abend kommen wir nach ein paar Stunden Zugfahrt in Ajmer an. Die Stadt wirkt chaotisch, hektisch, laut. Mein Kopf dröhnt. Wir nehmen eine Rikscha zum Busbahnhof und fahren gleich weiter nach Pushkar, einem kleinen Hindu-Pilgerdorf westlich von Ajmer. Auf der Fahrt beginnt meine Lunge zu schmerzen. Ich schiebe es auf die schlechte Straßenluft und binde den Schal um’s Gesicht. Der Bus ist übervoll, viele stehen, ein kleiner Junge schläft binnen Minuten an Karimes Schulter gelehnt ein. Zu Glück ist es stockfinster. So sehen wir nicht, dass unser alter Bus, dessen Bremsbeläge schon lange das Zeitliche gesegnet haben, über schmale, enge Bergstraßen nach Pushkar fährt, sich zuerst einen hohen Hügel hinaufquält und anschließend stinkend und hupend hinabrollt. So sehen wir zum Glück die Abhänge nicht. In Pushkar finden wir ein Zimmer im Everest Hotel, wieder ein Glücksgriff. Das Zimmer ist blitzsauber, das Hotel hat eine wunderschöne Dachterrasse und einen schwarzen Wach-Labrador namens Lion, der direkt vor unserem Zimmer schnarcht und ab und zu die Straßenhunde anknurrt.
12.11.14 Pushkar
Am Morgen verschlägt es mir fast den Atem, als wir auf der Dachterrasse unseres Hotels stehen. Die Stadt breitet sich zu unseren Füßen aus. Terrasse reiht sich an Terrasse, Dach an Dach. Bunte Wäsche flattert im Wind, Langurenaffen klettern über Geländer, springen von Hauskante zu Kante, erhaschen ein Stück altes Chapatibrot und lassen die langen Schwänze an den Hausrändern hinunterbaumeln, während sie in der Sonne entspannen. Hoch über den Häusern flattern die Drachen der Kinder im Wind; wie von Geisterhand gezogen ziehen sie ihre Bahnen. Die Jungen stehen auf den Dächern und ziehen an den Angelschnüren, jede Bewegung lässt die Drachen höher und höher steigen. Freunde entdecken die farbigen Drachen des anderen und rufen sich über die Dächer hinweg zu. Ich freue mich, als ich auch ein Mädchen im Hof spielen sehe. Man sieht so selten Mädchen spielen.
Hinter den Häusern schimmern die Berge blau, grau und grün am Horizont. Auf ihren Wipfeln stehen kleine Tempel. Pushkar ist ein Wallfahrtsort für hinduistische Pilger. An den Ghats, den Terrassen am Wasser, baden Männer und Frauen. Schilder bitten Touristen nicht zu fotografieren. Junge Inder machen dafür Fotos von uns mit ihren Smartphones.
Wir laufen um den See. In einem Pavillion sitzen Sadhus und Aussteiger, rauchen Gras und laden uns ein. Arayn ist einer von ihnen. Sein Name sei bedeutungslos, sagt er. Wir könnten ihn Yoga nennen, oder was auch immer aus unserem Herzen sprechen würde. Yoga zeigt uns die Behausung der kleinen Kommune, ein winziges Zelt, dessen Schrein gleich mehreren Göttern gewidmet ist: dem Elefantengott Ganesha, Krishna und Kali, der Göttin der Zerstörung. Unter ihrem Bild brennt das ewige Licht. Yoga sagt, es brenne seit 12 Jahren. Ginge es aus, passiere etwas Schlimmes in der Welt. Wir tippeln vorsichtige um die Schicksalsflamme ins Innere des Zelts und bekommen eine kurze Einführung in die hinduistische Mythologie. Zum Abschied schenkt Yoga uns noch zwei Holzperlenketten. Seine Freunde sitzen ordentlich bekifft um Kalis Flamme und lächeln uns zufrieden hinterher, während wir barfuß unseren Weg um den See fortsetzen.
Im Dorf wird der Jahrmarkt abgebaut. In der Woche zuvor fand hier der große Kamelmarkt statt, zu welchem tausende Händler und Touristen alljährlich in den kleinen Ort strömen. Hotelpreise schnellen dann in die Höhe und viele bekommen gar keine Zimmer mehr und schlafen auf den bloßen Steinen am Fluss. Nun schauen wir auf die Skelette der Fahrgestelle, das verwaiste Riesenrad, die Händler, die noch die letzten staubigen Kamelsättel an den Mann bringen wollen. Aus Pushkars Tempeln dröhnen die Klänge der Zeremonien. Der Ort ist erfüllt von einer Welle aus dumpfem Trommeln, aus Gesängen und dem Läuten der Glocken.
Am Bazaar verfolgen uns die vermeintlichen Priester und wollen uns Punkte auf die Stirn malen, uns Blumen und Armbänder andrehen. Für einen Obolus selbstverständlich. Die vibrierende Atmosphäre wird durchbrochen von den tüchtigen Geschäftsleuten, Geldwechslern, den kläffenden Straßenhunden und unzähligen Mopeds, welche pausenlos hupend haarscharf an uns vorbeibrausen. Wir wollen uns eine riesige Hupe kaufen und schmieden ganz unspirituelle Rachepläne. Die Kühe schlurfen unbeeindruckt durch die Gassen, pflastern die Straßen mit ihren Fladen, fressen Müll, liegen im Müll, oder mitten auf der Kreuzung, als wären sie taub, oder einfach nur unglaublich dickfellig.
Hier und da schnaufen Schweine um die Ecken, gefolgt von ihren quiekenden Frischlingen. Aufgeschreckt von den Kläffern hopsen sie durch die Gassen, wühlen sich durch den Müll, die Abwasserkanäle, die Jauchegruben.
Wir verschnaufen auf der Dachterrasse, während die Stadt hupt, schreit, vibriert, singt, trommelt, quiekt und bellt. Am Abend bekomme ich Fieber.
13.11.14 Pushkar
Ich bleibe im Bett. Nach vielen Stunden bei 39,5 °C schlucke ich eine Paracetamol und schleppe mich auf die Terrasse. Ich habe keinen Appetit, esse ein paar Löffel Curry und Reis, eine Banane, trinke eine Schokomilch. Ich verspüre kaum Lust mich zu bewegen und sitze stundenlang auf dem Dach, schaue den Drachen nach, beobachte die Languren.
14.11.14 Pushkar
Auch heute schlendert Karime ohne mich durch die Stadt. Ab und zu schaut er vorbei und bringt Kekse, Wasser, Bananen oder einen Tee. Ich dampfe mit 39+°C im Bett und habe auf nichts Lust, keinen Appetit, schlafe nur. Meine Brust schmerzt. Ich huste trocken vor mich hin. Mittags gehen wir zum Arzt. Von den Wänden des Krankenhauses bröckelt der Putz. Ich zahle 5 Rupees (6 Cent) und werde in ein Zimmer geschickt, in welchem mich zwei unmotivierte Männer von der anderen Seite eines sehr großen Schreibtisches aus anstarren. Ich erzähle von meinem Husten, dem Fieber. Niemand hört meine Brust ab, misst Puls oder Blutdruck. Stattdessen schickt man mich direkt ins Labor zum Malariatest, was ich sinnlos finde und entsprechend missmutig über mich ergehen lassen. Vor dem Labor steht das Wasser im Abwasserkanal, die Mücken schwirren umher, ein Junge zittert unter einen dicken Decke und wartet auf seinen Bluttest. Innerhalb einer Minute habe ich zwei dicke Mückenstiche am Knöchel. Wenn ich mir Malaria zuziehen sollte, dann hier, denke ich. Der Laborant piekst mir in den Finger und quetscht zwei Tropfen Blut auf eine Glasscheibe. Ich solle in zwei Stunden wiederkommen.
Natürlich ist der Test negativ. Mein Fieber scheint nun nicht mehr interessant. Ich stehe allein in den Krankenhaushallen, kein Arzt, nirgends. Vor der Klinik liegen die Kühe in ihrem eigenen Dreck. Ein paar Schweine futtern einen frischen Fladen. Zerknirscht gehe ich zurück in mein Zimmer und verschwinde im Bett. Krank sein ist Mist. Großer Mist. Ich will nach Hause. Das Thermometer zeigt 39,9 °C.
15.11.14 Ajmer
Mein Körper ist unendlich schwer. Meine Lunge ist gefüllt mit Beton. Fester Beton. Ich japse und huste. Meine Lippen sind vertrocknet. Ich sehe ziemlich scheiße aus.
Das Fieber geht nicht runter. Also packen wir unsere Sachen und fahren zurück nach Ajmer. Ich bin traurig, weil Pushkar so schön ist, und ich alles verschlafen habe. Ich will noch einmal in Ajmer zu einem Arzt gehen, will Pillen, will diese Reise erleben und habe Angst, zwei, drei Wochen krank zu bleiben.
In einer Privatklinik bekomme ich zuerst eine entspannende Inhalation an einem Beatmungsgerät verabreicht, ein weitere Bluttest schließt Denguefieber aus, und man verschreibt mir einen Haufen Tabletten und Antibiotika. Der junge Arzt kümmert sich besonders sorgsam um mich und während ich an meinem Inhalator vor mich hin entspanne, fragt er Karime drei Löcher in den Bauch zu Deutschland, unseren Universitäten und wie er wohl an ein Stipendium kommen könnte. Irgendwann kommt ein Kollege vorbei, zieht ihn weg und sagt: „Patient time“.