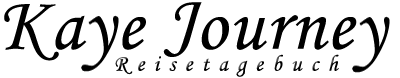21.11.14 Agra – Mathura – Varanasi
Wir fahren die Nordstrecke über Mathura, Lucknow, Faizabad und Jaunpur nach Varanasi und ich bin aufgeregt, weil ich lieber aus einem fahrenden Zug gucke als auf das fleckige Fliegengitter unseres billigen Hotels oder die lange Nebenwirkungsliste meines tollen, kortisonhaltigen Hustensafts. Der direkte Weg war ausverkauft, doch ich habe die Beziehung zu meinen Viren beendet und will sie lieber schnell in Agra zurücklassen. Zunächst müssen wir nach Mathura; dort fährt unser Zug ab. Mathura liegt etwa eine Stunde entfernt. Agras Busbahnhof ist winzig. Ein paar staubige Busse stehen auf sandigem Boden und die Ticketverkäufer rufen die Zielstädte aus den langsam anfahrenden Klapperkisten, von denen ich inzwischen glaube, dass sie schon so aus dem Werk kommen. Niemand ruft Mathura. Am Auskunftsschalter werden wir auf unbestimmte Zeit vertröstet und der Beamtenarm winkt sehr grob in eine Ecke zwischen Staub und Limonadenverkäufer, in die irgendwann unser Bus einrollen soll. Wir können die Schriftzeichen auf den Frontscheiben nicht lesen, weil wir schlauerweise nicht einmal die Hindizahlen gelernt haben. Also hocken wir auf der Bordsteinkante, knabbern an Bananen und springen im 5-Minuten-Takt auf um nach Mathura zu fragen. Nach 45 Minuten das erlösende Lächeln und Kopfwackeln. Wir hopsen rein. Händler versuchen riesige Pakete, Kisten und Netze voller Waren in den Bus zu stopfen, was ich als wahnsinnig aussichtslos belächele, doch Minuten später ist alles im Bus, der Fahrer sitzt eingequetscht hinter seinem Lenkrad, und wir hoffen, dass die Händler auch in Mathura aussteigen, denn vorher kommen wir hier nicht mehr raus. Außer durch die Fenster. Denn der Bus hat keine.
Wir erreichen den Bahnhof im Dunkeln; es ist ziemlich frisch und unser Zug hat vier Stunden Verspätung. Also hocken wir in der Bahnhofskantine, essen erst scharf gewürzte Linsen mit Reis und Brot und trinken anschließend einen Alibi-Tee nach dem anderen um weiter dort sitzen und Karten spielen zu dürfen. Jedes Fleckchen unseres Bahnsteigs ist belegt. Eingewickelt in Decken oder auf den blanken Steinen schlafen Frauen, Männer und Kinder zwischen Koffern, Taschen und Essensresten. Hier und da guckt ein Fuß unter Decken und Gepäck hervor. Kühe schlendern gemütlich um Köpfe und angezogene Beine herum, wühlen durch weggeworfene Tüten und Obstschalen oder schlecken Soßenreste aus Aluminiumtöpfen. Gegen Mitternacht ist es bitterkalt. Die liegenden Massen rücken noch näher zusammen und ich bin wieder einmal erstaunt, dass niemand auch nur ansatzweise knurrt als eine erneute Verspätung angezeigt wird. Chai-Verkäufer stehen an dampfenden Kesseln und rufen nach Kundschaft. Das Bistro hat inzwischen geschlossen. Kurz nach 1 Uhr rollt der Zug ein und das große Wimmeln geht los. Wieder springen Menschen in den noch rollenden Zug. Wir stehen natürlich am falschen Ende, sprinten unseren Betten hinterher und stolpern fast über die noch liegenden Körper. Nur eine Hälfte der Wartenden ist aufgesprungen. Die andere Hälfte wohnt heute Nacht auf den Steinen dieses Bahnsteigs.
Wir haben, weil es der unverdiente Zufall so wollte, den Wohlstand in der Hosentasche und heute Nacht sogar ein Abteil ganz für uns allein. Lucknow, Faizabad, Jaunpur rollen an unser vorbei, doch ich schlafe tief und fest bis Varanasi, träume 17 Stunden lang im ruckelnden Zug, der mich in einen seligen Schlaf lullert. Ich bin wie ein Kleinkind, das gewogen werden will, weil es so weiß, dass da jemand ist, dass es nicht alleine ist, dass irgendwas passiert.
22.11.14 Varanasi
Es ist 18:30, dunkel und wir machen einen Fehler. Der Ausgangspunkt ist ein anstrengender Motorrikschafahrer, welcher partout nicht losfahren will als wir uns weigern einen Hotelnamen zu verraten. Er will seine Kommission, doch wir wollen alleine gucken und alleine Preise aushandeln. Der Typ bockt so lange bis wir laut fluchend wieder aussteigen und ihm in Gedanken einen Platten im Vorderrad wünschen. Wieder sind wir Frischfleisch für die Rikschamafia. Das Verhandeln ist anstrengend, weil man nicht nur erst veräppelt wird (es gibt offizielle, feste Preise, die an einer Tafel stehen und auch einen Taximeter in jeder Rikscha, welcher jedoch für Touristen nie eingeschaltet wird), sondern gleich auch noch eine Klette abschütteln muss, die jedem Hotelbesitzer zuwinkt und den Zimmerpreis hochtreibt. Gut, jeder muss sein Geld verdienen, ich versuche es zu verstehen. Doch plötzlich steht da ein Mann mit einem netten Gesicht, einem netten Fahrpreis und, naja, einer Fahrradrikscha. Wir kennen die Entfernungen nicht, doch schon liegen unsere 10kg-Rucksäcke auf dem wackeligen Sitz und wir krabbeln davor. Nun gibt es ja tolle, leichte Fahrräder mit Gangschaltung, Alurahmen und Scheibenbremsen. Unseres ist anders. Mit unserem Fahrrad kannst du einen Motorrikschafahrer erschlagen. Es hat einen massiven Rahmen, einen großen gebogenen Lenker, Rücktritt und einen Gang. Der tritt sich so schwer, dass unser Fahrer selbst auf schnurgeraden, horizontalen Straßen sein gesamtes Gewicht auf das tretende Bein stemmen muss. Wir bereuen unsere Wahl bereits nach zwei Minuten. Doch wie sollen wir dem Fahrer die versprochenen Rupees wieder ausreden? Wir hätten sie aus Respekt einfach bezahlen und ein neues Taxi buchen sollen. Stattdessen sitzen wir eine halbe Stunde oder länger unentschlossen hinter unserem schwitzenden, schuftenden Fahrer. Fahrradrikschas sind an sich eine tolle Sache. Würden alle Rikschafahrer auf Räder umsteigen, gäbe es weit weniger Smog und das endlose Hupkonzert würde durch seichtes, freundliches Klingeln ersetzt. Doch mit unseren Rucksäcken wiegen wir zusammen vermutlich so viel wie ein Kalb. Ein größeres Kalb, eines auf halbem Weg zur Kuh. Unser Rikschafahrer fährt gerade ein fettes Kalb durch Varanasi und strampelt sich ab, während wir aufgrund der merkwürdigen Beschaffenheit dieser Fahrgestelle über ihm thronen wie Prinz und Prinzessin. Doch er bringt uns sicher durch Varanasis verstopfte Straßen, erzählt uns dabei ununterbrochen und atemlos, dass er keiner dieser gierigen Mafiafahrer sei, dass er ein ordentlicher Kerl sei, einer, der die Stadt kenne, und dann sagt er noch ganz viel, was wir nicht verstehen, spuckt öfter mal aus, eine Lieblingsbeschäftigung indischer Männer und trinkt unser Wasser, was wir ihm sehr gern schenken.
Eden, Karimes Agra-Freund, ist im Singh Guest House. Ein Junge führt uns weg von der lauten Straße durch die engen Gassen am Shivali Ghat, hinein in einen wunderschönen Hof, eingerahmt von Zitronenbäumchen, mit Holz- und Steinbänkchen und einer Fontäne. In jedem Zimmer des gemütlichen zweistöckigen Hauses brennt Licht und wir werden mit einem entschuldigenden Kopfschütteln empfangen. Alles ist voll. Eden weit und breit nicht zu sehen. Es wird immer später und kälter und unsere Mägen grummeln, also machen wir uns sofort auf die Suche nach einer Alternative für die Nacht. Am Assi Ghat, dem Ort der südlichsten Ganges-Terrassen der Stadt, finden wir noch ein freies Zimmer im Chaitanya Gästehaus, das auf den ersten Blick ok, und auf den zweiten Blick furchtbar dreckig ist. Mäuse- und Echsenkot bedecken Bett und Schränke, die Regale sind so verstaubt, als wären die im Ganges beerdigten Menschen vorher direkt in unserem Zimmer verbrannt worden. Das fensterlose Bad riecht so wie ein fensterloses Bad riecht, in dem der Schimmel fast so alt wie das Haus ist. Wir schmeißen die Rucksäcke auf den Boden und gehen ins beliebteste Restaurant der Gegend, in eine Pizzeria, die – Italiener, verzeiht mir! – gar keine schlechten Pizzen und auch einen ziemlich leckeren Apfelstrudel mit Vanilleeis anbietet. Mit rundem Bauch schlüpfen wir anschließend in die Schlafsäcke, ich huste uns ein Schlaflied, und wir überlegen, was wohl unangenehm lauter ist, der röhrige Entlüfter in unserem Schlafzimmer (zu dem der Hausherr sagte, wir sollen ihn bitte niemals, wirklich niemals, ausschalten – der wusste schon, wie sein Bad riecht) oder das lautsprecherverstärkte Hindufest am Ghat (von dem der Hausherr vor vier Stunden behauptete, es würde in 30 Minuten beendet sein).
23.11.14
Wir flüchten um 8 Uhr am nächsten Morgen aus dem Hotel des Schreckens zurück ins Singh Guest House und bekommen ein gerade frei gewordenes Zimmer. In den nächsten Tagen lernen wir unsere neue Bleibe sehr zu schätzen. Unser Gästehaus, unser Hof und der kleine Garten sind wie eine Insel der Ruhe mitten in dieser verrückten, magischen, chaotischen, und für uns, die noch nichts verstehen und nur stauen können, wahnsinnigen Stadt. Eine Insel des Rückzugs, in der wir einen Tee trinken, ein Curry essen und die Batterie aufladen können.
Dies ist ein Tagebuch und ich bin keine Journalistin, aber trotzdem ein paar Daten zur Stadt. Varanasi hat 1,4 Millionen Einwohner und ist eine der ältesten, ununterbrochen bewohnten Städte der Welt. Und eine der Heiligsten. Sie gehört zu den sieben heiligen Städten des Hinduismus’, hieß mal Kashi, mal Benares, und Gläubige pilgern zum Ganges um in ihm zu baden und wieder sündenfrei aus den Fluten emporzusteigen oder – wenn die Lebensjahre zahlreich und die Falten tief sind – um hier zu sterben und am Fluss den endlosen Kreis der Wiedergeburten zu durchbrechen. Etwa 80 sogenannte Ghats, Terrassen und Treppenstufen führen an der Westseite des Ganges ins Wasser. Da die angrenzende Altstadt ein endloses Labyrinth winziger Gässchen, Häuser, dunkler Ecken, Kuhfladen, Höfe und schmaler Treppchen ist, sind diese Terrassen der beste Weg um von Süden nach Norden zu gelangen, und wir laufen sie in den 7 Tagen, welche wir in Varanasi verbringen, unzählige Male ab. Die Ghats sind die Quintessenz unserer persönlichen Varanasi-Erfahrung und ich werde vor allem darüber schreiben.
Wir gehen immer den gleichen Weg. Durch ein schweres, eisernes Tor verlassen wir unsere helle, friedliche Hostelinsel, drehen uns nach links und laufen durch eine kleine Gasse, vorbei an zumeist mindestens einem frischen Kuhfladen, einer wiederkäuenden Kuh, die im Schatten der engen Straße döst, einem kleinen Tempel, dunklen, spinnenverwebten Fenstern, hinter denen kleine Fernseher flimmern oder bunte Lichterketten an Shiva-Bildnissen blinken. Frauen sitzen, in wunderschöne Saris gekleidet, auf Sofas, Decken oder dem blanken Boden, schälen Zwiebeln, sticken oder verfolgen konzentriert eine indische Seifenoper auf den kleinen Bildschirmen. Die Häuser sind alt, angegraut und riechen muffig, die Balkone hängen traurig an den Fassaden und die Fenster sind löchrig, doch schielt man hinein, schlüpfen die Gedanken heimlich in ein indisches Heim, man sieht das schuluniformierte Töchterchen in Heften blättern während Mama Linsen sortiert und man würde so gern mit einem Löffel in der Hand zum Abendessen aufkreuzen und auch neben der Familie und dem dampfenden Topf Platz nehmen. Nun noch einmal links rum und wir stehen vor einem weiteren Eisentor. Wir schlüpfen hindurch und klettern eine sehr steile, schmale Treppe hinunter bis zum Ganges. Nun stehen wir etwas südlich des Shivala Ghats am Fluss. Sofort werden uns aus allen Ecken Bootsfahrten angeboten. Wir hören in dieser Woche etwa 1000 Mal „Boot, Sir?“ und antworten die ersten 100 Male „nein danke, später“, dann 300 mal „danke, haben wir schon gemacht“, dann 200 mal „NEIN, danke“, und dann etwa 400 mal „Haben Sie auch einen Helikopter?“. Ein verdutzt guckendes Gesicht, ein stummer Moment, und fix sind wir weitergezogen. Auf den Treppen spielen Jugendliche Cricket. Ein lauter Ruf und wir wissen, wir müssen uns ducken, denn die harten Bälle werden mit Vollspeed durch die Luft geschossen. Die Jüngeren sammeln sie auf, dafür dürfen sie dabei sein. Die kleinen Jungs, die 6- bis 10-Jährigen, dürfen das noch nicht. Sie spielen stattdessen mit Holzstöcken, hauen sie so fest auf einen Stein bis dieser hochspringt, und schlagen ihn dann so weit sie können mit einem gekonnten Schwung durch die Luft. Andere lassen Drachen fliegen. Höher und weiter, als wir es bisher gesehen haben. Die Varanasi-Jungs haben es drauf. Hunderte Drachen flattern über dem Ganges, über den Tempeln und den Dächern der Altstadt in der Luft. Drachenfliegen ist ohne Zweifel die Lieblingsbeschäftigung der varanasischen Kinder, zumindest der Jungs, denn Mädchen zwischen 6- und 15 Jahren sieht man selten und noch viel seltener etwas spielen.
Auf dem Weg nach Norden passieren wir zunächst die von uns so getaufte Shit-Avenue. Gleich hinter den Cricketspielern gibt es ein paar Terrassen, die wir nach dem ersten Tag immer weiträumig umlaufen. Wer gerad in der Gegend ist und ein größeres Geschäft zu erledigen hat, kann hier mit Blick auf den heiligen Fluss eine schöne Duftmarke unter vielen setzen. Mir müsste ein Fuß fehlen um genau hier einen Haufen hinzusetzen. Neben Hunderten anderen? Während wir diesen Ort immer mit schnellen Schritten ganz dicht am Wasser umgehen, sitzen oft ein paar Leute auf den unteren Stufen, quasseln, entspannen, beobachten den vorbeifließenden Ganges, waschen Wäsche oder baden gleich selbst. Hier, an der Shit-Avenue. Nach zwei Tagen beginne ich sie zu bewundern. Dieser Geruch toppt fast alles. Ich beginne sie wirklich zu bewundern und meine das auch nicht sarkastisch. Wer hier sitzen, mit Freunden lachen, das Leben genießen, der Pflicht und der Muße nachgehen kann, der ist so frei, der lebt so im Moment, der ist so unerschütterlich unantastbar, in meiner (verzerrt-orientalistischen) Vorstellung der Erleuchtung so nahe, dass mir kaum plattere Worte einfallen und ich sie nur bewundern kann. Ich wohne in einem Land, in dem der Nachbar verklagt wird, weil die Gartenzwerge zu hoch aus dem Gras ragen, wo die Wörter Lärmstörung und Polizeieinsatz oft in einem Satz genannt werden und das Verständnis östlicher Weisheit und Philosophie nur soweit reicht, wie die Solaranlage des Nachbarn nicht die Aura des teuer hergerichteten Feng Shui Gartens stört. Chillen neben Kacke, das ist Zen. Ich bin fasziniert.
Ein paar Schritte weiter laufen wir ins neue Extrem. Wir passieren das Harishchandra Ghat, eines von mehreren Burning Ghats, also Plätzen, an denen die Toten verbrannt werden. Ich habe zuvor noch nie einen Toten gesehen, fällt mir plötzlich ein. Neben den Scheiterhaufen spielen die Kinder Steinchen-Weitschießen. Ich sehe einen Fuß aus den Flammen ragen und schäme mich, weil ich nicht weggucken kann. Der Geruch brennt sich in meine Nase. Dieser süßliche Geruch, der mir Tag für Tag unangenehmer wird. Bald rieche ich ihn schon, wenn wir noch nicht mal in der Nähe des Ghats sind. Der Ort ist unwirklich. Ein paar Männer sitzen gelangweilt neben den brennenden Häufchen, doch ich lerne später in dieser Woche, dass sie nicht gelangweilt gucken, sondern sich zusammenreißen um keine Trauer zu zeigen. Fotografieren ist streng untersagt und es fällt mir schwer zu entscheiden, wie ich in meinem Blog damit umgehe. Denn eine bildliche Beschreibung sagt manchmal noch mehr als eine Fotografie und kann mindestens ebenso reißerisch sein. Ich versuche also ruhig zu beschreiben, was mich eigentlich im ersten Moment komplett aufwühlt. Denn dieser Fuß aus dem Feuer gehörte zu einem Menschen, und ich habe nicht die spirituelle Basis um das auszublenden. Dessen Geist oder Seele ist dem Glauben nach bereits entwichen, so dass ein Körper nur ein Körper, ein Hülle, aber kein Wesen mehr ist. Doch der Fuß ist real und sieht meinem eigenen in den Schlappen immer noch sehr ähnlich. Die spielenden Kinder, die fröhlich durch den süßlichen Qualm springen, schenken ihm weit weniger Beachtung als ich. Als wir das erste Mal hier vorbeikommen, brennen gerade zwei Haufen und ich sehe Vieles mehr als nur Füße, was ich nicht weiter beschreiben möchte. Am Fluss werden neue Holzbetten hergerichtet. Sechs Männer bringen eine Trage und legen sie am Ufer nieder. Darauf liegt ein in Tücher gewickelter Körper, bedeckt von Blumenkränzen und bunten Bändern. Er wird in das heilige Wasser getaucht, mehrmals. Am Kopf werden die Tücher etwas gelöst und Wasser auf das Gesicht geträufelt, ein fast zärtlicher Moment. Ziegen drängen sich durch die beobachtende Menge und knabbern die Blumen von der Brust des Toten, der nun aufgebahrt wird. Ein Brahmane spricht die richtigen Verse, dann wird das Feuer entzündet. Dies ist kein Ort der Stille. Touristen laufen unentwegt vorbei, stoppen, schauen, laufen weiter. Kühe und Ziegen belagern das Ufer und fressen den vorbeischwimmenden Unrat, Blumenkränze, Müll. Überall sitzen Männer, manche teilnahmslos, manche mit starrem Blick. Ich bin schwer irritiert als jemand seine Unterhose an einem brennenden Scheiterhaufen trocknet. Doch als ein Mann versucht Karime eine (nicht kostenlose) Handmassage aufzudrängeln, wird er von wütenden Beobachtern verscheucht. Dies ist trotz allem ein Ort des Respekts, ein heiliger Platz und Hindus, die es sich leisten können, möchten genau hier diesen Weg gehen, hier aufgebahrt werden.
In den nächsten Tagen, wenn wir noch unzählige Male hier vorbeikommen, werden wir noch viel lernen, und ein wenig mehr verstehen als heute.