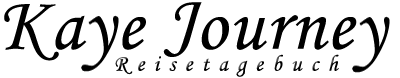28.11.14 Reise nach Kerala – Von Varanasi nach Kochi
Als wir aus dem Flugzeug steigen, wissen wir noch nicht, dass wir ein ganz anderes Indien betreten. 31 Grad Hitze drücken in unsere Poren; es ist verdammt schwül; der Körper will augenblicklich jede Bewegung einstellen.
Am frühen Morgen haben wir Varanasi verlassen. Ein Rikschafahrer fuhr uns durch die Kälte der Nacht zu Varanasis Flughafen. Die Straßen begannen bereits zu verstopfen, unbehelmte Schulkinder auf Rollern kreuzten unsere Spuren, in den kleinen Seitengassen brannten aufgehäufte Müllberge und verpesteten die Verkehrsluft mit einem zusätzlichen Geruch nach verbranntem Plaste. Die Kühe fraßen weggeworfene Blumen oder wühlten mit der Schnauze durch die verkohlten Müllhaufen. Die Sonne versteckte sich noch hinter dem Morgendunst. Unser Varanasi, das Varanasi der Ghats, der Terrassen am Ganges, der Mönche, Priester und Sadhus war ein spirituelles Varanasi. Doch endlos zog sich die Stadt; wir durchfuhren Viertel um Viertel, durchquerten Märkte in muslimischen Vierteln, in welchen die Männer Käppchen trugen und wo an jeder Straßenecke Moscheetürmchen zwischen den angegrauten Häusern hervorlugten. Wir durchfuhren die Ausfallstraßen, die Viertel, in denen Menschen jeden Morgen zum Sonnenaufgang mit der Arbeit begannen, wo ganztags ein Hupkonzert auf den Straßen die Geschäftigkeit der Bewohner dieser Stadt verkündete, der Mehrzahl dieser unermüdlichen Bewohner, die nicht tagein tagaus in spiritueller Versenkung die Stunden dahinziehen ließen, sondern das Schulgeld der Kinder, das Essen, die Miete, das Benzin für die Rikscha oder die Extramünzen für das kleine Häufchen Betelnuss-Tabak am Ende des Tages erarbeiteten.
Wir verlassen Varanasis Enge, schummeln uns in Backpacker-Überschallgeschwindigkeit mithilfe zweier Flüge in den Süden des Landes und schauen plötzlich ungläubig aus dem Busfenster auf die Straßen Ernakulams. Werbeschilder reihen sich an Werbeschilder, Diamanten, Möbel, Privatkliniken, Spas, Immobilien – das Schöne und das Teure wird angepriesen, kein Fleckchen Hauswand, Zaun oder Freifläche ohne Werbung. Ich bin, gelinde gesagt, etwas verwirrt, nein, richtig wäre, ich bin heimlich enttäuscht. Wir katapultieren uns aus der spirituellen Hochburg des Landes in eine kommerzielle. Der Unterschied könnte kaum größer sein. Hoch über dem Mittelstreifen unseres Highways wird eine S-Bahn Trasse gebaut. Hunderte Pfeiler stehen schon, dazwischen werkeln die orange behelmten Arbeiter, es wird geschweißt, gehämmert, Kräne ziehen Stahlträger nach oben, Zementmischer laufen auf Hochtouren. Hinter den Werbeplakaten stehen viereckige, graue Betonklötze, manche mit Glasfassade, meist zweistöckig, Autohäuser, Schmuckgeschäfte, Einkaufszentren, Tankstellen, riesige Hotelbunker und Fastfood Tempel. Wir schauen und schweigen. Unsere Blicke flackern gierig auf der Suche nach etwas Schönem in dieser gesichtslosen Stadt, doch Ernakulam zieht schmucklos an uns vorbei, die Sonne geht unter, es wird finster. Nach zwei Stunden Fahrt kreuzen wir erst eine, dann die zweite Brücke und wissen, wir haben unser Ziel erreicht: Fort Kochi, die Inselstadt an der tropischen Malabar-Küste, diese 600 Jahre alte Geschäftsstadt, die Gewürz- und Antiquitätenhochburg. Chinesen, Portugiesen, Niederländer, Engländer – sie alle wollten ein Stück abhaben vom Kuchen, den Kochi seit jeher versprach, kämpften um Einfluss und Macht, hinterließen ihre Spuren, bis heute.
Eine Rikscha bringt uns zu einem empfohlenen Homestay. Wir wollen die Kommission sparen und so erzähle ich dem Fahrer, ich müsse zum ESI Krankenhaus, welches sich laut Stadtkarte gleich in der Nachbarschaft befindet. Der Fahrer sagt, das Krankenhaus sei geschlossen, was ich als Masche abtue. Fix behaupte ich, ein befreundeter Arzt würde dort auf uns warten mit einer Extrasprechstunde nur für mich, weil ich doch so schlimmen Husten hätte und huste zum Beweis die gesamte Fahrt röchelnd vor mich hin. Der Fahrer biegt von einer dunklen Gasse in die nächste, plötzlich sind alle Geschäfte, Restaurants und Hotels verschwunden, dunkle Einfamilienhäuser verstecken sich hinter Zäunen, hier und da flackert ein Fernseher. Plötzlich stoppt er vor einem verfallenen, verrammelten Grundstück, abgeblätterte Farbe hängt traurig vom Metallzaun; ich sehe die Umrisse einiger zugenagelter Baracken und ein Krankenhausschild. Der Fahrer grinst schlau. Ich gönne ihm den Sieg nicht, zupfe Karime am Arm, bedanke mich höflich und laufe zielgerichtet auf den Zaun zu. Karime wedelt mit den Armen. Während unser Fahrer, immer noch lachend, seine Rikscha wendet, rüttele ich etwas an der verrosteten Kette, gerade so, als würde nun tatsächlich unser Arzt aus dem dunklen, hüfthohen Unkraut des Grundstücks emporsteigen und uns in seine Praxis führen. Karime wedelt inzwischen lautstark. Doch der Fahrer ist weg und ich bin die mit dem Stadtplan. Daher muss er mir folgen. Zwei, drei dunkle Wohnblöcke weiter unten, die Gassen sind inzwischen nur noch schulterbreit, erkennen wir ein kleines Schild: Green Woods Bethlehem. Halleluja. Wir haben es tatsächlich gefunden.
Sheeba und ihr Ehemann empfangen uns wie zwei zurückkehrende Kinder. Ihr Haus steht auf einem zugewaldeten Grundstück, Lianen hängen von den Bäumen, es zirpt und pfeift aus jedem Winkel, kleine Treppchen führen vom Haupthaus zu den Gästezimmern. Wir bekommen eines direkt neben der Hausbibliothek. Obwohl wir spät in der Nacht ankommen, zaubern uns die beiden noch ein köstliches Abendmahl aus Kartoffeln, Gemüse in Kokosnusssoße, süßem, weichen Weißbrot, Früchten und Tee. Und entschuldigen sich mehrfach, dass es nur noch Reste gibt. Wir wissen kaum wohin mit unserer Dankbarkeit.
In unserem Zimmer wachen solange diverse Maria-Ikonen über unsere Rucksäcke. Oder auch über die eintausend heimischen Mücken, die im Tümpel an der Rückseite unseres Hauses gerade nachtaktiv werden und sich zielgerichtet durch die Lücken unseres Schiebefensters quetschen. Nach drei Wochen sind wir zum ersten Mal heilfroh, dass wir ein Mückennetz durch Indien schleppen. Als wir schwitzend unter dem an den Ventilator geknüpften Netz liegen, müssen wir uns eingestehen, dass die amateurhaft gespannten Seiten ziemlich traurig runterhängen und wir beide, um die Plätze kämpfend, auf denen unsere Haut nicht das Netz berührt, vermutlich ein erbärmliches Bild abgeben. Die Faulheit siegt und am nächsten Morgen entdecke ich große, roten Flatschen auf Wangen, Po und meinen Zehen. Doch der pfiffige Karime hat bereits in der frühen Morgenstunde Fäden an die Netzseiten genäht, an Schränke und Fenster gebunden, und so wache ich in einem perfekt gespannten Himmelbett auf, draußen ruft der Dschungel, die Mücken sitzen verdrossen auf dem Gesicht des Baby-Jesus über unserem Bett. In den nächsten drei Wochen werden wir zu wahren Moskitonetz-Experten und schlafen nie wieder ohne.
29.11.14 Kochi
Beim Frühstück verlieben wir uns erneut in unsere Gasteltern. Es gibt Kokosnusspfannkuchen mit einer karamellisierten Ingwer-Kokosnussfüllung, süße, winzige Bananen, Melonen, Ananas, Milchbrot mit Marmelade und gekochte Eier. Urlaub im Süden. Genauso fühlt es sich an. Wir springen in die Flipflops, durchqueren unseren kleinen Hausdschungel. Die dunklen Straßen von gestern Nacht entpuppen sich als niedliche Gässchen, zu beiden Seiten reihen sich kleine und größere Familienhäuser aus Holz aneinander, alle Türen sind geöffnet, die kühle Morgenluft zieht durch die Wohnstuben, alles wirkt freundlich und einladend. Ein paar Kinder zeigen uns ihre französische Bulldogge, wir hören kein Wort Hindi mehr, in Kerala spricht man Malayalam. An einer grün-weißen Moschee biegen wir nach rechts ab, schlurfen zu einem kleinen Laden und kaufen Wasser. Es ist bereits erdrückend schwül und wir bewegen uns im Zeitlupentempo. Fort Kochi ist das Gegenteil Ernakulams. Ruhig, fast leer gefegt sind die Straßen, die Zeit vergeht langsam, keine Hochhäuser säumen die Straßen, sondern kleine Häuschen und schmucke Villen, an jeder Straßenecke steht eine Kirche. Die Schule heißt St. Joseph’s Boys School, die Kathedrale Santa Cruz Basilica, die Eckkirchen Church of our Lady oder Church of God. Hindutempel, heilige Kühe, Fehlanzeige. Hier haben die Engländer und Portugiesen missioniert, was das Zeug hielt, und die Einheimischen leben die christliche Tradition ebenso eifrig und spirituell, wie wir es aus dem hinduistischen Norden kennen, versammeln sich zu Hunderten vor den kleinen Altären der Eckkirchen, preisen, die Arme in die Höhe reckend, Maria und Jesus, kaufen und verkaufen endlos viele Devotionalien, Ikonen, Kreuze, Rosenkränze, knien betend vor den Statuen. In den größeren Kirchen werden die Gottesdienste auf einem großen Flachbildschirm übertragen. Ich weiß nicht, mit welchen Mitteln die Europäer ihren Glauben hier verbreitet haben, allein dass sie es getan haben, wird bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Meinungen hervorrufen. Christliche Missionierung ruft bei mir wenig positive Assoziationen hervor, doch auch der Hinduismus wurde zu irgendeinem Zeitpunkt immer weiter ins Land getragen; jede Zeit hinterlässt ihre Spuren und sie alle sind nun Teil dieses Indiens, welches wir besuchen gekommen sind. Als ich gestern Nacht nochmal durchs Haus schlich um Wasser zu kaufen, las mein Gastvater unter seinem Jesusschrein so versunken in der Bibel, dass ich seinen Glauben einfach mit gleichem Interesse bestaunen musste, wie den seiner hinduistischen oder buddhistischen Landsleute aus dem weit entfernten Norden. Überhaupt sind nur 1% aller Inder Buddhisten, dafür aber 2% Christen; das klingt wenig, sind aber nach indischen Maßstäben etwa 24,5 Millionen Menschen. Daneben gibt es unter anderen etwa 200 Millionen Muslime und etwa eine Milliarde Hindus. Da bekommt das Wort Minderheit einen ganz anderen Unterton.
Zwischen den kleinen Kirchen stehen die Moscheen. Fünfmal am Tag ertönt auch hier aus allen Ecken der Stadt der Ruf des Muezzins. Das Leben auf den Straßen tröpfelt gemütlich dahin. Es ist still, fast einsam in den kleinen Gassen. Katzen und Hunde sehen gesünder aus als im Norden. Vor den frisch gestrichenen Häusern stehen schicke Geländewagen neben der Royal Enfield. Die Werbeschilder auf der anderen Seite der Brücke erklären sich von selbst. Die Menschen hier sind zweifellos etwas wohlhabender als ihre Landsleute aus dem Norden. Oder vielleicht ist das Geld auch nur anders verteilt. 1957 hatte der Staat Kerala die erste demokratisch gewählte kommunistische Regierung der Welt und die Kommunistische Partei hat seitdem als Regierungs- oder Oppositionspartei über Jahrzehnte politischen Einfluss behalten. Bis heute. Auf den Straßen Keralas, zwischen Werbeplakaten, zwischen Palmen, an den Ufern der Flüsschen der Backwaters: Überall wedeln die roten Fahnen, Hammer und Sichel-Graffitis zieren Hauswände, auf den Begrünungsinseln der Straßenkreuzungen stehen Plakate mit dem Konterfei Lenins, Marx’ oder auch Che Guevaras. Das partizipatorische politische System sorgte bisher dafür, dass Macht, Einkommen und vor allem Land etwas gerechter und ausgeglichener verteilt wurden; Gesundheits-, Bildungssystem und Alphabetisierungsrate sind Vorbilder für den Rest des Landes. Doch der bescheidene Wohlstand kommt nicht nur aus Kerala selbst. Viele Familien bekommen regelmäßig Schecks aus dem mittleren Osten, zum Beispiel aus Dubai, aus Qatar oder aus den Emiraten, wo Verwandte die unter der heißen Wüstensonne hart erarbeiteten arabischen Riyals und Dirhams in Briefumschläge stecken und Richtung Heimat schicken.
Dennoch, meine heimliche Enttäuschung ist verschwunden. Gestern wollte ich weiterhin mein Indien so sehen, wie ich es mir vorstellte. Mit Menschen, die meditierend allem Kommerz entsagen, mit Kindern, die sich nur über einen einfach gebastelten Drachen freuen können. Dass sich die Kinder hier auch über ein Playstationspiel freuen, dass sich ihre Eltern eine sichere, moderne Gesundheitsfürsorge für die Familie wünschen, dass Jugendliche technisch und qualitativ bestens ausgestattete Universitäten besuchen möchten – all das blendet man als verwöhnter westlicher Tourist gern aus, gerade so als müsste man das spirituelle Indien schützen, weil das, was uns daheim geboten wird, uns alltäglich und normal erscheint – das IPad neben dem IPhone auf der Hutablage des Range Rovers – weil wir es als unveränderbar, als gegeben hinnehmen, dass wohlhabende Menschen sich so etwas leisten, und gleichzeitig wissen, dass ein Streben aller (noch) sieben Milliarden Menschen dieses Planeten nach gleichem Wohlstand zu seinem Kollaps führen wird. Es wäre doch alles so viel nachhaltiger, so viel ausgewogener und gleichzeitig so tief sinngebend spirituell, wenn die indischen Kinder einfach mit Ihrem kleinen Papierdrachen zufrieden wären, weiter im Fluss badeten und später wie der Papa Fahrradrikscha führen. Oder? Und wenn sie dann schon ein Auto kaufen, dann am besten einen Volkswagen. Wir machen es uns gern so einfach. Und verändern lieber die anderen nach unserem Bild, als uns selbst.
Am Nordhafen lassen die Fischer die riesigen chinesischen Fischernetze ins Wasser. Sie ziehen kaum noch einen Fisch an Land und können schon lange nicht mehr von dieser Arbeit leben. Über dem Fluss wächst eine dicke Schicht Pflanzen. Mit langen Lanzen und Keschern fischen die hageren Männer das Grünzeug aus den Netzen; wir zählen eine Handvoll fingergroße Fische pro Netz. Sie machen es dennoch. Zur Wahrung des kulturellen Erbes, vor allem jedoch für die Touristen. 10 Millionen trampeln inzwischen jährlich durch Kerala und der Staat hofft, dass zukünftig weniger Väter und Mütter nach Dubai abwandern und dafür Gästehäuser, Cafés oder kleine Reiseagenturen eröffnen.
Die Fischer versuchen sogleich Touristen auf ihre Plattformen zu locken. Für das Vorführen ihrer Fischerkünste werden sie anschließend um einen nicht unerheblichen Obolus bitten. Wir lehnen dankend ab. Auch später auf dieser Reise werden wir noch feststellen, dass man Verkäufer mit dem Ablehnen eines Produkts oder einer Dienstleistung regelrecht verärgern kann. Wir sind die Touristen mit dem schmalen Portemonnaie und – läuft eine 50- bis 60-jährige amerikanische Reisegruppe mit rotverbrannten Waden und Baseball Cap vorbei – gleich nicht mehr interessant.
So schlendern wir an Ständen mit Holzperlenkettchen, Plastik-Nudelpressen, „Ali Baba Hosen“, Schmuckschatullen, Tabla Trommeln und allerlei religiösem Schnickschnack vorbei.
Ein Straßenverkäufer fällt mir auch. Seine bescheidenen Waren, ein Dutzend Magneten und Räucherstäbchen, trägt er in einer Plastiktüte mit sich herum, immer wieder spricht er uns an, solange bis er mein Herz erweicht. Ich kaufe ihm einen Magneten für unseren Kühlschrank ab. Erfreut über das kleine Geschäft, stellt er sich uns als Manu vor, als Manu, der Hochzeitssänger. Als wir ihm erzählen, dass wir auch Musik machen, steigert sich seine Hibbeligkeit ins Unermessliche. Er kramt ein zerknülltes Blatt Papier aus seinem Beutel und fragt mit glänzenden Augen, welcher Michael Jackson Song unser liebster wäre. Auf dem Blatt finden wir eine lange Liste aller Hits und gruseln uns kurz. Doch schon trällert Manu herzallerliebst Billie Jean und I wanna rock with you, vergisst kurz den Einstieg von Bad, wird rot und gleich noch aufgeregter. Da wittert er die Chance seines Lebens und bittet uns, ihn für ein Konzert nach Deutschland zu holen. Ob wir ihm nicht ein paar Gigs besorgen könnten. Leider hätte er keinen Pass, aber da könnten wir doch sicher auch was machen, oder? Dabei ist er so überzeugt davon, endlich die richtigen Menschen getroffen zu haben, dass es uns fast peinlich ist, ihm keine Flausen in den Kopf zu setzen. Es wäre ein Leichtes gewesen, ihn anzuschwindeln und ihm das Blaue vom Himmel zu erzählen. Doch wir holen ihn wieder herunter von seinem Wölkchen und versprechen, dass wir sein Bild in unserem Blog und auf unserer Facebook-Seite posten werden, und ihn so zumindest in unserem Freundeskreis bekannt machen. Was hiermit getan ist. Manu freut sich riesig über unseren Vorschlag, wir machen das Foto und er geht fröhlich seines Weges. Als ich mich noch einmal umdrehe, preist er seine Räucherstäbchen bereits dem nächsten Touristenpärchen an. Manu, der träumende Straßenhändler.
Wir laufen von Fort Cochin nach Mattancherry und passieren Gewürzfabriken, in denen es nach getrocknetem Ingwer duftet, laufen durch Straßen, in denen jedes Geschäft nur Reis und nichts als Reis anbietet, begutachten bestimmt einhundert Buddhastatuen, die man uns für 200-2000 Dollar das Stück andrehen will, geben uns als Experten für Rubine und Bronzeantiquitäten aus, werden von muslimischen Brüdern („Karime, mein Blut ist dein Blut“) mit Tee und Keksen bezirzt, freuen uns über Gastfreundlichkeit und ärgern uns, wenn man uns wieder übers Ohr hauen will. In einem Geschäft erzählt man, dass die wertvollen Statuen aus dem Nachbarladen innerhalb von 6 Tagen nachgebaut werden können. Alles kein Problem, alles Original! „Wie viele brauchen Sie?“ Ich weiß nicht, warum, aber man hält uns für Großhändler. Seide, Paschmina, Schmuck, Teppiche, Schränke, Tische, massive Holzschaukeln für den Garten – all das will man gern sofort einpacken. Zum „friendly Price“. DHL. Alles kein Problem. Einmal brauchen wir geschlagene 40 Minuten um uns wieder aus einem Kaufhaus zu winden.
Am Ende des Tages kaufen wir eine kleine Tüte Cashewkerne, eine Melone und ein Bündel Bananen. Zufrieden sitzen wir auf der Terrasse unseres Gästehauses, eingehüllt in eine Wolke Mückenspray. Doch die Moskitos sind in Topform und stechen genau dort, wo wir nicht gesprüht haben und zwar in jeden einzelnen unserer Zehen.
30.11.14 / 1.12.14 Kochi – Alappuzha
Am Morgen drückt Sheeba uns herzlich an ihre Brust und ein Abschiedsküsschen auf unsere Wangen. Mit Gottes Segen und ihrem großartigen Frühstück im Bauch geht es im Bus von Kochi nach Alappuzha, weiter in den Süden des Landes.
Alappuzha oder Alleppey, wie viele Einwohner es noch immer nennen, ist nicht annähernd so schön und ruhig wie Fort Kochi, doch wir nutzen die Stadt als Sprungbrett in die Backwaters, die Flüsschen und Kanäle, welche das hintere Land durchziehen und welche als Hauptattraktion Keralas gelten. Die halbe Stadt scheint nur davon zu leben, an allen Ecken und Enden werden uns Haus-, Motorboote und Kanus angeboten. Wir wissen um die ökologischen Probleme des Backwater-Tourismus’ und natürlich wäre es besser, einfach gar nicht hinzufahren, doch wir entscheiden uns für die sanfteste Variante und buchen ein muskelbetriebenes Paddel-Kanu, welches wir uns mit Katey aus Großbritannien teilen.
Anil, unser Kanufahrer trägt Latschen und, so wie die meisten Männer in Kerala, ein Wickeltuch als Rock sowie ein gebügeltes Hemd. Er lebt in den Backwaters; später werden wir bei ihm zu Hause zu Mittag essen.
Die Häuser der Backwaters stehen auf schmalen Landstreifen. Ein endloses Raster aus Kanälen zieht sich durch das Land, dazwischen liegen Reisfelder oder Becken für die Schrimpzucht. Wir sehen bescheidene Hütten, unverputzt, manche nur mit einem Wellblechdach oder Wänden aus Bastmatten. Wir sehen auch verputzte Steinhäuser mit niedlichen Gärten und immer wieder sehen wir auch eine Villa mit verspiegelten Fenstern, Elefanten- und Löwenskulpuren vor massiven Eingangsportalen. Andere haben gar keine Fenster. Allen gemeinsam ist die Außentoilette auf dem Grundstück.
Wir fahren zunächst durch einen sehr breiten Kanal und sind umzingelt von motorisierten Hausbooten. Etwa 100 Euro kostet eine Übernachtung auf diesen Booten. Inklusive ist der Bootsführer und ein Koch. Natürlich waren diese Hausboote auch für uns reizvoll. Nun sind wir froh, dass wir keines gebucht haben. Der Kanal ist ein wahrer Hausboothighway. Dutzende Boote schippern an uns vorbei und pusten ihren schwarzen Qualm in die schöne Natur. Bald, wenn es keine Fische und Schrimps mehr gibt und das Wasser zu schmutzig ist, um damit die Reisfelder zu bewässern, werden die Bewohner keine andere Wahl mehr haben, als Touristen mit Motorbooten durch die Kanäle zu schiffen. Falls dann noch Touristen kommen.
Wir halten an einer kleinen Chai-Bude und essen Frühstück. Es gibt Porotha, ein fettiges, wahnsinnig leckeres Brot, was wir erst hier in Südindien entdeckt haben, und eine scharfe Aloo Masala Soße. Ich liebe das indische Frühstück immer mehr. Mein Gaumen ist inzwischen gelangweilt von Muffins, Toast und Marmelade. Er verlangt nach scharfen, ordentlich gewürzten Soßen und heißem, schwarzen Tee mit Milch und Honig, am besten zu jeder Tageszeit.
Auf einem Spaziergang sehen wir die abgestreifte Schlangenhaut einer Kobra. Die Rassel steckt noch am Schwanzende. Weniger Meter weiter hinten stehen die Bauern mit hochgezogenen Hosen knietief in den Reisfeldern. Sie laufen gebückt durch den schlammigen Boden, große Sensen in der Hand, und es gibt sicher keine Berufsunfähigkeitsversicherung der Welt, die einen indischen Reisbauern mit Schlangenphobie versichern würde.
Anil pflückt Bananenblätter. Seine Frau Jainda wird uns darauf das Mittagessen zubereiten. Ihr gemeinsames Haus ist keine der Villen, auch keines der verputzten Betonhäuser. Die Beiden bewohnen mit ihrem 10-jährigen Sohn ein unverputztes Steinhaus ohne Fenster und ohne Mückennetz. Für Karime und mich streicht Jainda das Laken ihres Bettes glatt, legt eine Bastmatte darauf, breitet die Bananenblätter aus und serviert. Wir hocken im Schneidersitz auf der Matratze. Es gibt Bananencurry, Okraschoten, Keralareis, einen kleinen, frittierten Fisch und eine Art Joghurt-Buttermilchsoße. Wir essen mit den Fingern. Alles ist würzig und köstlich. Wir verputzen auch die letzten Krümel und schon rollt Jainda die Bastmatten wieder zusammen. Das Bett ist nun Schlafplatz für Anil und seinen Kanufahrerkollegen. Die Beiden verabschieden sich zum Mittagsschläfchen und so verputzen wir unseren Nachtisch draußen im Garten. Jainda ist immer wieder abgelenkt, als ich versuche, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Im Viertel wurde geheiratet. Wir konnten die Hochzeitsgesellschaft von den Booten aus beobachten und nun reckt Jainda bei jedem Getuschel hinter der Hecke den Hals und versucht zu erlauschen, wer dort vorbeiläuft und was man sich von der Hochzeit erzählt. Klatsch und Tratsch in indischen Vorgärten.
Ich schlendere am Uferweg entlang. Flussaufwärts steht ein kleiner Tempel. Eine alte Frau sitzt versunken vor einem Mikro und liest laut in hinduistischen Schriften. Die Lautsprecher plärren ihren monotonen Gesang kilometerweit durch die Backwaters. Die Hochzeitsgäste, Jainda und unser schlafender Kanufahrer, die ältere Dame aus dem Süßigkeitenladen an der anderen Ecke des Dammes: Sie alle werden beschallt und nehmen es hin. Die vedischen Gesänge gehören schon den gesamten Tag zur Geräuschkulisse. Ein junger Mann fährt auf mich und den Tempeleingang zu, klettert aus seinem Motorboot und schöpft vor dem Betreten des Tempels noch einmal eine Hand Wasser aus dem Fluss, sprenkelt liebevoll den Eingang zum Tempel. Wasser ist Freund, Transportweg, Nahrungslieferant, Lebensgrundlage. Es sind die kleinen religiösen Gesten, die sich mir einprägen und die ich verstehen lerne, nicht die machtvollen Dogmen, Klerus und Priesterschaft, die hierarchische Ordnung und die großen Schriften, von denen ich so wenig weiß, sondern die Art wie Menschen mit individueller Achtsamkeit das Mystische und Spirituelle in ihren Alltag integrieren, nachspüren, erfahrbar machen.
Wir rudern zurück. Vor uns setzt eine Fähre über den Fluss und ein Dutzend Kinder springt ans Ufer. Unter ihnen ist Anandu, Anils Sohn, und er winkt seinem stolzen Vater kurz zu, schwingt sich die Schultasche auf den Rücken und läuft den Freunden nach.
Am Abend geben wir uns dem Genuss hin, gönnen uns zunächst eine ayurvedische Massage und anschließend ein großes Mahl im Thaff Restaurant. Das Thaff ist unser neues Lieblingsbistro; hier sind wir meist die einzigen nichtindischen Gäste. Der Tisch ist gedeckt mit Porotha, Idyappam Fladen, Gemüse Curry, Reis und Butter Chicken. Mit rundem Bauch liegen wir in der Nacht im Bett. Karime hört Air. Ich höre noch immer die Tempelfrau singen. Höre die Tablas trommeln.
02.12. – 03.12.14 Alappuzha – Kollam
Am Morgen schütte ich mir einen Eimer kalten Wassers über den Kopf. Seit Wochen duschen wir auf diese Weise, doch es stört mich schon lange nicht mehr. Man vertrödelt keine Zeit im Bad und vergeudet weniger Wasser. Eine Kelle über den Körper, einseifen, abspülen, fertig. Natürlich ist dies leicht getan, wenn das Außenthermometer die 30 ° C kratzt.
Auf dem Boden des Zimmers wächst an diesem Morgen ein wildes Durcheinander aus Reisekarten, Büchern, Stiften und Notizzettel. Wir fühlen das erste Mal unsere Rückflugdaten im Nacken. Indien hat uns eingesogen, es gibt noch so viel zu sehen, doch wir haben unseren Eltern versprochen, dass wir diesmal nicht umbuchen und Ende Dezember wie verabredet nach Hause kommen. Wir verplempern einen ganzen Vormittag mit Kopfkratzen, Debattieren, Planen, dem Umschmeißen und Verschieben von Reiseplänen, planen unsere Route nach Mumbai, zählen Tage, checken Zug- und Busrouten.
Gegen Mittag rumpelt unser Bus Richtung Süden. Wir können die Backwater von Kerala nicht mit einem einzigen Ausflug abhaken; wir reisen sowieso schon viel zu schnell. Doch Kollam ist ein staubiges Loch. Am Busbahnhof buchen wir ein Boot für den nächsten Tag und schon wimmelt ein Hotellotse um uns herum. Wir sind genervt und laufen einfach weg, doch der klettenhafte Mann hat nichts Besseres zu tun und fährt in seiner Rikscha stur neben uns her, während wir unsere Rucksäcke durch die Mittagshitze Richtung Innenstadt schleppen. Irgendwann fährt er dann leicht vor uns, so dass wir auch noch seine Abgase einatmen dürfen. Im Zentrum ist es noch smoggiger als am Hintern seiner Rikscha. Eine riesige Baustelle gräbt sich durch die Hauptstraße. Verdrossen, verschwitzt und eingestaubt stehen wir im Gewühl der shoppenden Menschen und wissen erst mal gar nichts mehr. Kein Restaurant wirkt einladend, die Hotels sehen nach Bunkern für Geschäftsreisende aus, es ist unfassbar lärmig und wirklich nicht hübsch. Eher häßlich. Doch zwischen den Billigkrimskramsläden, den Obstständen, DVD Dealern und Klamottengeschäften entdecken wir die Fassade des Nani Boutique Hotels, dieser kleinen hübschen Insel inmitten des Stadtzentrums. Die Zimmer sind viermal so teuer wie unsere Durchschnittsbehausung, doch sie sind auch sehr viel schicker. Wir ziehen ein. Das blitzeblanke Bad, die großen Kissen, weißen Laken und der trübe Fensterausblick haben die erwartete Wirkung auf Karime. Noch vor 21 Uhr schläft er fest wie ein Baby.
5 Uhr morgens. Die Stadt erwacht langsam. Es ist noch dunkel, doch aus den Moscheen ertönen die Gebetsrufe, das Hupen auf den Straßen wird lauter. Wir bleiben noch zwei Stunden liegen, packen zum x-ten Mal unseren Sachen und bitten die Rezeption sie ein paar Stunden wegzuschließen.
Das indische Frühstück bekommt Karime gar nicht gut. Dabei ist es so lecker. Es gibt Kartoffel- und Reisfladen, Currysoße, Vada, eine Art indischer ungesüßter Donut, scharfes Potato Puri und Chai. Doch sobald wir anschließend einen Fuß aus dem Hotel setzen, beginnt Karimes Magen zu grölen und fordert lautstark die Rückkehr in die Lobbytoilette. Nach dem dritten Mal tippe ich nervös mit dem Fuß. Unser Boot wartet und die Rikschafahrer streiken. Hört der Bauch nicht bald auf zu grölen, können sie streiken so lange sie wollen. Doch Karime hebt den Daumen. Los geht’s. Wir sprinten zum Busbahnhof.
Eine Stunde später sitzen wir in einem Kahn und rudern durch die Kanäle von Munroe Island. Karime ist selig. Den GoPro Gimble in der Hand hockt er schweigend am Kopfende unsere Barke und filmt Kokospalmen, Ananas- und Chilipflanzen, Pfefferbäume, Eisvögel, Kormorane, Entchen und Kühe, folgt den Libellen mit der Kamera, stapft durchs hohe Gras und filmt Grashalme. Unsere Mitreisenden halten ihn sicher für einen besonders naturverbundenen Jungen, doch Karime filmt für ein Musikvideo und man müsste schon in die tiefen, verschlungenen Fantasiewelten seines schweigsamen Kreativkopfes eintauchen um wirklich zu verstehen, was er da eigentlich macht. Meist weiß es nur Karime. Und meistens wird es am Ende großartig.
Die Kanäle sind winzig und die Brücken so flach, dass wir uns mehrmals bäuchlings in die Barke legen müssen um unbeschadet darunter hindurch gleiten zu können. Unser Guide leitet uns im Stocherkahn durch das Labyrinth der vielen Flüsschen. Auch er trägt wie unser Guide am Vortag ein Hemd sowie einen Wickelrock. Wer ein Textiliengeschäft in Indien plant, sollte sich auf Hemden spezialisieren, gern bunt kariert oder gestreift. Ihr wolltet T-Shirts verscherbeln? Vergesst es. Wenn überhaupt, dann Polohemden. Ohne Hemdkragen gehen die indischen Männer selten aus dem Haus. Frauen tragen oft wunderschöne Saris mit bauchfreien Tops oder die sehr komfortable Kombination aus einer weiten Hose und einem knielangen, kleidähnlichen Hemd gleicher Farbe. Dazu trägt frau ein Tuch über Brust und Schultern. Die Hosen sind immer knöchellang. Sieht man eine nackte Wade, gehört sie vermutlich einem touristischen Gast oder einem Südinder mit hochgefaltetem Rock. Nackige Beine gelten auch heute noch als ein Zeichen unterer Kastenzugehörigkeit, auch wenn es diese natürlich offiziell nicht gibt; wer es sich leisten kann, trägt langes Beinkleid.
Am Nachmittag stehen wir am Bahnhof von Kollam. Es geht wieder nach Norden. Wir wollen ein paar Tage nach Munnar fahren, ein kleines Örtchen in den Bergen an der Grenze zum Staat Tamil Nadu. Eine 3-stündige Zugfahrt nach Ernakulam, eine Nacht in einem billigen Bahnhofshotel und fünf Stunden wackelige Busfahrt auf engen Bergstraßen liegen vor uns.
Im Zug werden wir zu beliebten Gesprächspartnern. Joan spricht uns zuerst an. Sie besucht die Universität in Kollam und studiert Technologie und Kommunikation. Heute war Prüfungstag, doch Joan hat ein gutes Gefühl. Es ist ihr letztes Studienjahr. Bald wird sie einen Job suchen und finden, da ist sie ganz Optimistin. Ich frage, was ihr so vorschwebt und sie umschreibt vage eine Anstellung im Mobilfunksektor. Joan hat 12 Jahre in Doha, der Hauptstadt Qatars, gelebt, so wie viele ihrer keralischen Landsleute. Sie schwärmt in den höchsten Tönen von dieser Zeit, hat ihre gesamte Schulzeit dort verbracht. Die Eltern arbeiten noch immer dort. Doch das Studium in Kerala kostet umgerechnet nur etwa 80 Euro im Jahr und so lebt Joan nun in ihrem Studentenwohnheim oder, wie jetzt am Wochenende, bei den Großeltern und kann sich wieder eine Zukunft in Indien vorstellen. Über unseren Reisestil schüttelt sie hingegen nur den Kopf. „Ihr habt keine Hotelbuchung, keinen Guide? Ihr reist ganz allein, ohne Plan, ohne Landeskenntnisse?“ Ja, so ist es. Wir runzeln kurz die Stirn darüber, dass die Weltbürgerin Joan das kaum fassen kann, und sind dann doch wieder ganz stolz auf uns, zwinkern mit den Augen und fühlen uns wie tollkühne, bewunderte Backpacker. Und genau jetzt bekomme ich einen Hustenschub und krächze den Stolz aus der Brust. Wir sind einfach auch schon oft mit einem blauen Auge davon gekommen.
Ein Mann auf der gegenüberliegenden Sitzbank spendiert mir einen Tee.
Schnell hat er mein Herkunftsland erraten und beginnt seine Ideen von Kommunismus und Kapitalismus gegeneinander abzuwägen, spricht über die soziale Marktwirtschaft und das, was noch davon übrig ist. Die Zukunft seines Landes sieht er mit Schrecken. Immer mehr Bereiche des noch öffentlichen Sektors würden privatisiert, die öffentlichen Verkehrsmittel, Schulen, die Gesundheitsfürsorge, sogar Wasser und Saatgut gehören nicht mehr der Natur, sondern einer Handvoll Firmen. Die Partei der Hindunationalisten mache ihm Angst. Er spricht von den vielen Minderheiten Indiens, den Sikhs, Moslems, Jains, Juden, Buddhisten und Christen, den ethnischen Säuberungen, die bereits stattgefunden hätten und stattfinden würden und als er die Methoden der rechtskonservativen, hindu-nationalistischen BJP Partei mit denen der Nazis vergleicht, von Völkermord spricht, mischen sich die anderen Fahrgäste ein und beginnen lauthals mit ihm zu streiten. Ich kann dem Englisch-Malayalam-Hindu-Mix-Gespräch nur noch eingeschränkt folgen, doch es ist unmissverständlich, dass die Mehrzahl der anderen Fahrgäste seine Ängste nicht teilt. Im Gegenteil, sie sehen eine Modernisierung Indiens mit einer hinduideologisch untermauerten Kultur positiv, sehen ihre Werte gespiegelt, die Werte der Mehrheit. Mein Gesprächspartner besteht darauf, dass die BJP Faschismus propagiere, dass sie eine Gefahr für die Demokratie sei. Man einigt sich darauf, dass man sich nicht einigen kann. Irgendwann schweigen alle. Ein paar Minuten später werden Samosas herumgereicht. Auch wir bekommen eine Portion geschenkt. Alle teilen und essen gemeinsam; die politischen Grabenkriege sind zumindest kurz vergessen in dieser riesigen Demokratie mit 1,2 Milliarden Stimmen.